Wie wir die Zukunft sehen
Bildung mit 7 Forderungen nachhaltig machen
Das youpaN unterstreicht in seinen neuen Forderungen die Rolle der Kinder- und Jugendbeteiligung für eine nachhaltige Zukunft. Mit einer Bildungsvision und konkreten Zielen und Maßnahmen möchte das youpaN eine Bildung schaffen, die soziale Gerechtigkeit und Frieden ermöglicht. Dabei sollen auch die Grenzen unseres Planeten berücksichtigt werden. Um das zu erreichen, müssen wir die Bildung verbessern.
Die Forderungen sollen dazu beitragen, dass BNE im Bildungssystem schneller umgesetzt wird. Vor allem sollen junge Menschen dabei aktiv mitgestalten und -entscheiden.
Untergliedert sind diese Forderungen in 7 Handlungsfelder auf der Bundesebene:
I. Engagement fördern
II. Kinder – und Jugendbeteiligung stärken
IV. Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Sinne von BNE
V. Zukunftsorientierte Bildungspolitik
VI. Transformative Wissenschaft und Institutionen
VII. Verankerung von BNE im Bildungssystem
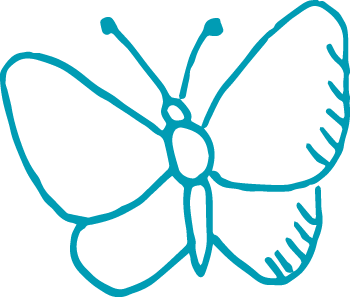
Hier kannst du alle unsere Forderungen nachlesen

I. Engagement foerdern
Menschen sollen motiviert werden, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren. Dazu braucht es Freiräume, Zugänge und finanzielle Unterstützung. Zum Beispiel soll es ein kostenloses Deutschland-Ticket für Ehrenamtliche geben.
Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement in Deutschland ist in vielen Bereichen zu finden, u. a. in der Kultur, der Bildung, dem sozialen Bereich, der Feuerwehr, der Politik und vielen Lebensbereichen mehr. Indem wir Menschen – jung oder alt – durch Freiräume, Zugänge und finanzielle Res-sourcen motivieren, nachhaltig über ihr ganzes Leben hinweg zivilgesell-schaftlich aktiv zu werden, entfalten wir eine transformative Kraft, die durch Selbstbestimmung, Eigenmotivation und Selbstwirksamkeit ent-stehen kann.
Ziel 1: Engagement gesamtgesellschaftlich ermöglichen
1. Die Empfehlungen, die im Zuge der Beteiligungsformate zum Nationalen Aktionsplan Kin-der- und Jugendbeteiligung von jungen Menschen und Expert*innen der Jugendarbeit erarbeitet werden, werden von der Bundesregierung verbindlich umgesetzt.
2. Ab 2024 werden die vom Bund geförderten Stipendien als Chancen-, Bildungs- und Ehren-amtsstipendien neu strukturiert. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) sowie alle weiteren Stipendiengebende informieren über diese Angebote auf einer bundesweit einheitlichen Webseite.
3. Ab sofort werden in allen Bundesländern einheitliche Ehrenamtskarten für gesellschaft-liches Engagement eingeführt und gegenseitig anerkannt. Für den Erhalt dieser Karte ist ein Nachweis für das Ehrenamt und die Erfüllung bundesweit einheitlicher Vorgaben Vo-raussetzung.
4. Ein qualitativer Ausbau der bereits bestehenden Freiwilligendienste wird ab sofort mit am BAföG-Höchstsatz orientierter Bezahlung und freier Fahrt im ÖPNV über kostenlose Deutschlandtickets veranlasst. Darüber hinaus braucht es eine gesteigerte Wertschätzung durch Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildung / Studium.
Ferner sollen Schulen Informationsveranstaltungen anbieten, bei denen sich lokale Jugendverbände und -initiativen (bspw. Mitglieder der Stadt- und Landesjugendringe), die frei von diskriminierenden oder menschenfeindlichen Orientierungen sind, vorstellen können, um den Schüler*innen Möglichkeiten des außerschulischen Engagements aufzuzeigen.
Von den Bildungsministerien und Schulleitungen fordern wir eine Selbstverpflichtung, gemeinsam mit den Landesschüler*innenvertretungen auf die Erfüllung der geschilderten Forderungen hinzuarbeiten und Schule sowie das Schulsystem selbst demokratischer zu machen.

II: Kinder- und Jugendbeteiligung staerken
Junge Menschen sind wichtig für die Demokratie. Ihre Meinungen und Wünsche müssen berücksichtigt werden.
Dabei ist es wichtig, dass dies angemessen geschieht. Deshalb fordert das youpaN:
– Absenkung des Wahlrechts bei der Bundestagswahl auf 16 Jahre
– Aufnahme der Kinderrechte der Vereinten Nationen ins Grundgesetz
– Verankerung und Überprüfung echter Jugendbeteiligung in allen Bildungsprogrammen auf Bundesebene
Junge Menschen sind die Zukunft und diese gilt es zu sichern. Sie sind unmittelbar von den Entscheidungen und Herausforderungen der Gegen-wart betroffen. Daher ist die Stärkung wirksamer Kinder- und Jugend-beteiligung von entscheidender Bedeutung, um junge Menschen in den demokratischen Prozess einzubeziehen sowie ihre Perspektiven und Anliegen angemessen zu berücksichtigen, denn Demokratie muss erlernt, gelebt und gestaltet werden.
Ziel 1: Demokratiebildung und politische Bildung stärken
1. Die Fördermittel für Bildungsangebote, um Demokratie zu erlernen und zu stärken, sowie die der Bundeszentrale für politische Bildung werden ab 2025 im Bundeshaushalt mindes-tens verdoppelt.
2. Bis 2025 werden bundesweit finanzielle Anreize für Bildungsorte geschaffen, Lernende dauerhaft als Entscheidungsträger*innen einzubeziehen und an der Leitung der Bildungs-orte zu beteiligen (z.B. Einsatz als studentische Präsident*innen etc.).
Ziel 2: Beteiligung gesetzlich verankern
3. Die Kinderrechte werden bis 2025 im Grundgesetz verankert.
4. Zur Bundestagswahl 2025 wird das aktive und passive Wahlrecht auf 16 Jahre gesenkt.
Ziel 3: Kinder- und Jugendbeteiligung unterstützen und ausbauen
5. Wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung an Bildungsorten wird ab sofort in allen bundes-weiten Bildungsprogrammen festgeschrieben und ein Mechanismus zur Überprüfung der Umsetzung eingeführt.
6. Die Förderung des BNE-Kompetenzzentrums für Prozessbegleitung und Prozessevaluati-on (BiNaKom) wird fortgeführt und erweitert, um mehr Regionen aufzunehmen und dabei durch gestärkte Prozessbegleitungen den Ausbau von Kinder- und Jugendbeteiligung in Kommunen voranzutreiben.
3. Bildungsgerechtigkeit und Antidiskriminierung
Bildung muss für alle Menschen offen sein, unabhängig von Herkunft,
Identität oder Fähigkeiten. Dafür braucht es unter anderem mehr Geld. Diskriminierung
muss abgebaut werden.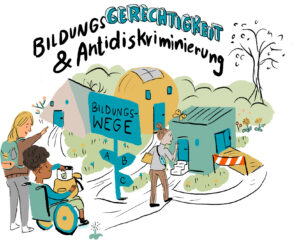
Wir fordern zum Beispiel:
– Mindestlohn für Auszubildende
– Ausbau des BAföG ohne Abhängigkeit von den Eltern
– psychische Gesundheit in Bildungsorten fördern
Als Leitperspektive der Vereinten Nationen ist „Leave no one behind“ das zentrale, transformative Versprechen der Agenda 2030 sowie der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). In der Bildung bedeutet das, allen Menschen die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe, unabhän-gig der eigenen Herkunft, Identität oder Fähigkeiten zu ermöglichen.
Ziel 1: Allen Menschen Bildung gleichermaßen ermöglichen
1. Die beratende und ideelle Förderung von Lernenden wird ausgebaut, um allen die glei-chen Start- und Entwicklungschancen zu geben – unabhängig von ihrer jeweiligen finan-ziellen Situation.
2. Finanzielle Unterstützung von allen Lernenden wird durch den Ausbau des Elternunabhängigen BAföG gewährleistet.
3. Bund und Länder erarbeiten gemeinsam ein Ganztagskonzept, das auf freiwilliger Basis einen Zugang zu kulturellen Angeboten (z.B. das Erlernen eines Instrumentes) schafft und so Privilegien abbaut.
4. Ein Mindestlohn für alle Auszubildenden wird zum Start des Ausbildungsjahres 2025/26 eingeführt.
Ziel 2: Psychische Gesundheit in allen Bildungsorten priorisieren und schützen
5. Bis 2026 erarbeiten Bund und Länder unter Einbezug der Zivilgesellschaft und Expert*in-nen – inklusive junger Menschen – eine gemeinsame, mit finanziellen Mitteln zur Umset-zung bestückte Strategie zum Umgang mit mentaler Gesundheit, psychischen Erkrankun-gen und Diskriminierung.
6. Dazu werden bereits bestehende Konzepte evaluiert und eingepflegt. In diese Strategie gehören Fortbildungs- und Aufklärungsmaßnahmen, sowie die Veränderung, Schaffung und der Ausbau von Strukturen (z.B. die Schaffung unabhängiger Meldestellen undEmpowerment-Räume).
7. Alle Bildungsorte fördern einen Kulturwandel, der den Leistungsdruck durch allgemeine Achtsamkeit ersetzt.
Ziel 3: Sicheren Zugang zu Beteiligungsformaten für alle schaffen
8. Für Bundesbeteiligungsverfahren werden im Dialog mit den Mitgliedern der aktuellen Ju-gendbeteiligungsgremien sowie Expert*innen und Jugendverbänden Standards für dis-kriminierungsfreie Strukturen und die gemeinsame Arbeit formuliert und umgesetzt. So sollen Safer Spaces für Betroffene geschaffen werden, in denen sie frei ihre Perspektiven teilen können.
9. Ab sofort werden Lehrende und Entscheidungstragende auf allen Ebenen durch Schulun-gen für Diskriminierung in Beteiligungsprozessen sensibilisiert.

IV. Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Sinne von BNE
Um Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen zu fördern, muss man sie in allen Bereichen berücksichtigen. Alle Beteiligten sollen in den Konzepten von BNE geschult werden. Dazu gehören Fortbildungen für Leitungen an Bildungsorten wie Schulleitungen und Hochschul-Präsidien. Außerdem gibt es Schulungen für Bildungspolitiker*innen und ihre Mitarbeiter*innen durch Expert*innen aus der Wissenschaft. Auch junge Menschen können sie dabei beraten. Gesetze zu Fort- und Weiterbildungen müssen verändert werden: BNE muss ein fester Bestandteil davon sein.
Die Umsetzung von BNE in Bildungseinrichtungen erfordert eine ganz-heitliche Betrachtung von Nachhaltigkeit. Dies wird über die gemein-same Gestaltung des Whole Institution Approach in den Institutionen gewährleistet. Sowohl Mitarbeitende der Lerneinrichtung als auch die Entscheidungsträger*innen im Bildungssystem müssen in den Konzepten und Inhalten von BNE weitergebildet werden.
Ziel 1: Verpflichtende Fortbildungen zu BNE für alle Lehrenden und Erziehenden einführen
1. Bestehende Förderprogramme des Bundes werden bis 2025 ergänzt, um an allen Bil-dungsorten Fortbildungen für Lehrende und Erziehende zu BNE zu finanzieren.
Ziel 2: Fortbildung für Entscheidungsträger*innen einführen
2. Ab sofort werden Fortbildungen für Kita- und Schulleitungen, Hochschulpräsidien sowie weitere Leitungen von Bildungsorten gefördert. Dadurch wird die Implementierung von BNE an deren jeweiligen Einrichtungen vorangetrieben. Die Möglichkeit zur Verpflichtung einer solchen Fortbildung wird geprüft.
3. Ab der nächsten Legislatur werden Fortbildungen für (angehende) Bildungspolitiker*in-nen und Mitarbeiter*innen von Ministerien sowie der öffentlichen Verwaltung zu BNE, deren Relevanz im Bildungssystem und möglichen Maßnahmen zur Umsetzung von BNE angeboten. Diese werden von Expert*innen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis der BNE geleitet – insbesondere sind auch junge Menschen daran beteiligt.
Ziel 3: BNE in den Weiterbildungsgesetzen verankern
4. Das Berufsbildungsgesetz (BBiG), die Weiterbildungsgesetze der Länder selbst sowie das Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz (AFBG), sollen auf die neuesten technologischen und inhaltlichen Standards gebracht werden und so auch BNE verankern.

V. Zukunftsorientierte Bildungspolitik
Die Bildungspolitik für die Zukunft muss immer wieder prüfen, ob sie ihre Verpflichtung aus Art. 20a des Grundgesetzes zum Schutz zukünftiger Generationen erfüllt. Dabei wird BNE als wichtiger Teil der politischen Meinungsbildung betrachtet. Zudem sollen die Nachhaltigkeitsziele als Leitfaden für staatliche Finanzierungen dienen. Neue Gesetze in der Bildungspolitik sollen auf Zukunfts- und Generationengerechtigkeit geprüft werden.
Der deutsche Rechtsstaat hat sich im Grundgesetz, Art. 20a, zum Schutz der zukünftigen Generationen verpflichtet. Eine zukunftsfähige Bildungspolitik erkennt BNE als Teil reflexiver politischer Meinungsbildung an und versteht, dass es für eine Transformation in der Gesellschaft auch eine Transformation im Bildungssystem braucht.
Ziel 1: BNE in allen Bildungsbereichen ausreichend fördern
1. Die Einrichtung einer am Nationalen Aktionsplan BNE orientierten Förderrichtlinie zur strukturellen Stärkung von BNE-Akteur*innen wird bis 2030 etabliert und eingesetzt.
Ziel 2: Nachhaltigkeitsziele als Leitfaden staatlicher Finanzierungen setzen
2. Steuern auf klimaschädliche Produkte werden erhoben und klimaschädliche Subventionen schrittweise zurückgefahren. Außerdem wird eine Vermögenssteuer erhoben, um die nachhaltige Transformation unter anderem in der Bildung zu stützen und die sozialen Fol-gen des Klimawandels abzufedern.
3. Finanzierungen der Landes- und Bundesregierungen werden ab 2030 auf die Zukunfts- und Generationengerechtigkeit geprüft.
Ziel 3: Wissenschaftlich fundierte Gesetze unter Beteiligung der Gesellschaft erarbeiten
4. Gesetzesentwürfe und KMK-Beschlüsse werden vor der Verabschiedung auf Zukunfts- und Generationengerechtigkeit sowie deren Beitrag zur Umsetzung von BNE im Bildungs-system geprüft.
5. Es wird ein Expert*innenrat einberufen, welcher sich aus Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie Lernenden und insbesondere auch jungen Menschen, zusammensetzt. Dieser berät Entscheidungsträger*innen in Sachen Bildung (z.B. im Bundestag oder in der KMK) und vertritt die Stimme aller relevanten Stakeholder*innen in Entscheidungsprozessen.

VI. Transformative Wissenschaft und Institutionen
BNE führt zu einer Nachhaltigkeits-Transformation, die in allen Bildungsorten im Sinne des Whole Institution Approachs angestoßen und beschleunigt werden muss.
Transformative Wissenschaft kann helfen, Krisen zu bekämpfen und die Gesellschaft widerstandsfähiger zu machen. Sie liefert Erkenntnisse, die Entscheidungen unterstützen. Dazu muss die Politik unter anderem Forschung für Nachhaltigkeit und transformative Wissenschaft besser fördern.
BNE führt zu einer Nachhaltigkeitstransformation, die in allen Bildungsorten im Sinne des Whole Institution Approachs angestoßen und beschleunigt werden muss. Transformative Wissenschaft liefert dabei Grundlagen für die Bekämpfung von Krisen, kann zur Resilienz der Gesellschaft beitragen und Entscheidungen auf Erkenntnisgrundlagen ermöglichen.
Ziel 1: Forschung für Nachhaltigkeit (FONA) stärken
1. Die FONA-Strategie wird nach Beendigung evaluiert und staatlich gefördert weiterge-führt.2.Für Forschungsmittel der öffentlichen Hand werden Nachhaltigkeitsstandards der For-schungsarbeit entwickelt und ab 2025 in allen Ausschreibungen berücksichtigt.
Ziel 2: Transformative Wissenschaft fördern
3. Im Haushalt 2025 werden Gelder für die Gründung von Zentren für transformative Wissen-schaft bereitgestellt. Diese sollen die transformative Wissenschaft voranbringen, weiter-denken, ausbauen, evaluieren und Methoden stetig weiterentwickeln.
4. Zivilgesellschaftliche Vertreter*innen werden ab sofort durch Projektbeiräte an der Defi-nition von Forschungsprogrammen auf Bundesebene beteiligt.
Ziel 3: Reallabore ausbauen, Umsetzung der Erkenntnisse im Wissenschaftssystem fördern
5. Reallabore werden in Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen verstärkt gefördert.
Ziel 4: Nachhaltigkeitstransformation im Sinne des Whole Institution Approachs umsetzen
6. Für alle Unternehmungen, die den Betrieb von Bildungsorten betreffen, werden aus dem Whole Institution Approach Standards entwickelt. Diese Standards werden ab 2027 bundesweit eingesetzt.

VII. Verankerung von BNE im Bildungssystem
Damit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wirken kann, muss sie in allen Bildungsbereichen fest integriert werden. Die Regierungen auf Bundesebene und in den Ländern sollen sagen, wie sie das umsetzen wollen. Es ist wichtig, dass die Politik klare Pläne macht. Diese Pläne sollten gut zusammenpassen und von allen eingehalten werden.
BNE ist ein zentraler Schlüssel zur Verwirklichung der SDGs. Um die Wirksamkeit von BNE zu stärken, ist die strukturelle Verankerung von BNE in allen Bildungsbereichen weiter und verstärkt zu fördern. Bund und Länder müssen transparent nachvollziehbar machen, wie sie ihren Verpflichtungen angesichts der Herausforderung nachkommen wollen. Im politischen Handeln bedarf es einer klaren Priorisierung, einer stärkeren Kohärenz und überzeugenden Verbindlichkeit.
Ziel 1: BNE in Bund und Ländern im Bildungssystem verankern
Für die Verankerung und Umsetzung von BNE im Bildungssystem werden regelmäßige, mehrmals jährlich stattfindende Treffen zwischen Bund und Ländern auf Handlungsebe-ne im Anschluss an den nächsten Bildungsgipfel 2024 eingerichtet. Dabei soll ein stetiger Austausch- und Beschlussvorbereitungsprozess entstehen, welcher die Transformation des deutschen Bildungssystems unter Einbindung weiterer relevanter Stakeholder*innen – insbesondere der Lernenden – voranbringt.




